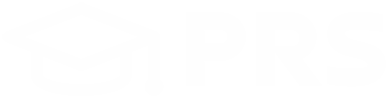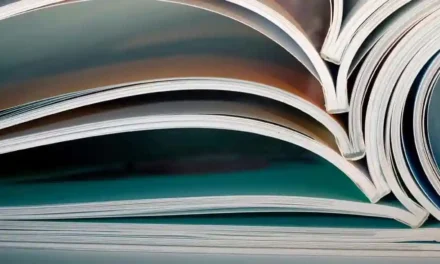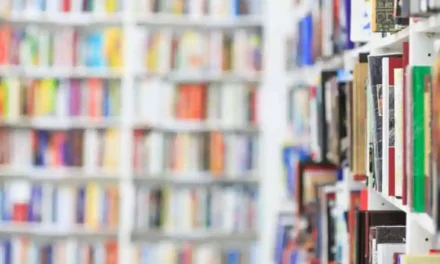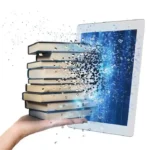Einleitung
Die wissenschaftliche Publikationslandschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich gewandelt. Mit dem Aufkommen von Open Access (OA) als Alternative zum traditionellen Subskriptionsmodell ist eine Debatte entbrannt, welche Form der Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen langfristig die beste ist. Eine der umstrittensten Varianten ist das sogenannte Hybrid Open Access. Dabei handelt es sich um ein Modell, bei dem Autor*innen die Möglichkeit haben, gegen eine Gebühr ihre Artikel in ansonsten kostenpflichtigen Zeitschriften frei zugänglich zu machen. Doch ist dieses Modell eine dauerhafte Lösung oder lediglich eine Übergangsstrategie auf dem Weg zu einem vollständig offenen Publikationssystem?
Was ist Hybrid Open Access?
Hybrid Open Access ist ein Mischmodell, das Elemente des traditionellen Subskriptionsmodells mit Open Access verbindet. Wissenschaftliche Verlage bieten hierbei Autor*innen die Option, einzelne Artikel durch eine Article Processing Charge (APC) offen zugänglich zu machen, während der Rest der Zeitschrift weiterhin hinter einer Paywall bleibt. Dieses Modell soll einerseits die Finanzierung der Verlage sicherstellen und andererseits den Bedürfnissen der Open-Access-Bewegung Rechnung tragen.
Vorteile von Hybrid Open Access
1. Erhöhte Sichtbarkeit und Zitierfähigkeit
Ein zentraler Vorteil von Hybrid Open Access liegt in der größeren Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse. Frei zugängliche Artikel werden häufiger gelesen und zitiert, was den wissenschaftlichen Einfluss der Veröffentlichungen steigert.
2. Sofortige Verfügbarkeit
Im Gegensatz zu grünen Open-Access-Modellen, bei denen oft Embargofristen gelten, sind Hybrid-Open-Access-Publikationen unmittelbar nach der Veröffentlichung für alle zugänglich.
3. Verbleib in renommierten Fachzeitschriften
Viele Forscherinnen bevorzugen es, in etablierten, hochrangigen Fachzeitschriften zu publizieren. Da viele dieser Zeitschriften nur als Hybrid-Modelle Open-Access-Optionen anbieten, ist dieses Modell für Wissenschaftlerinnen attraktiv, die sowohl hohe Sichtbarkeit als auch einen Verbleib in renommierten Journals anstreben.
Kritik am Hybrid Open Access
Trotz dieser Vorteile gibt es erhebliche Kritikpunkte, die das Hybridmodell als fragwürdig erscheinen lassen.
1. Doppelte Kosten (Double Dipping)
Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist das sogenannte “Double Dipping”. Bibliotheken und Universitäten müssen weiterhin Abonnementgebühren für hybride Zeitschriften zahlen, während gleichzeitig Wissenschaftler*innen hohe APCs entrichten müssen, um einzelne Artikel offen zugänglich zu machen. Dies führt zu einer doppelten Belastung der akademischen Institutionen.
2. Hohe Publikationsgebühren
Die APCs für Hybrid-Open-Access-Artikel sind oft deutlich höher als die für reine Open-Access-Zeitschriften. Dies stellt insbesondere für Forschende aus finanziell schwächer ausgestatteten Institutionen oder Entwicklungsländern eine erhebliche Hürde dar.
3. Fehlende Transparenz und Kontrolle
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Transparenz darüber, wie viel Geld insgesamt für Hybrid-Open-Access-Publikationen ausgegeben wird. Viele Hochschulen und Forschungsorganisationen haben Schwierigkeiten, ihre Publikationsausgaben effizient zu verwalten.
Hybrid Open Access als Übergangslösung
Angesichts dieser Kritikpunkte stellt sich die Frage, ob Hybrid Open Access eine nachhaltige Lösung oder nur eine Übergangslösung darstellt. Viele Open-Access-Befürworter*innen argumentieren, dass Hybridmodelle lediglich eine Zwischenstufe auf dem Weg zu einem vollständig offenen Publikationssystem sind.
1. Plan S und die Forderung nach vollständigem Open Access
Initiativen wie Plan S, die von einer Koalition europäischer Forschungsförderer unterstützt wird, fordern, dass wissenschaftliche Publikationen, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, sofort frei zugänglich sein müssen. Hybrid Open Access wird in diesem Zusammenhang nur als vorübergehende Lösung akzeptiert, solange es Teil eines Transformationsvertrags ist, der langfristig zu reinem Open Access führt.
2. Transformationsverträge als Brücke
Viele Wissenschaftsorganisationen setzen auf Transformationsverträge, um den Übergang von hybriden zu vollständigen Open-Access-Modellen zu erleichtern. Dabei zahlen Institutionen pauschale Gebühren an Verlage, um sowohl Lese- als auch Publikationsrechte zu garantieren, mit dem Ziel, die Subskriptionsmodelle schrittweise abzuschaffen.
3. Entwicklung neuer Open-Access-Modelle
Parallel dazu entstehen neue Open-Access-Modelle, wie das sogenannte “Diamond Open Access”, bei dem weder Leserinnen noch Autorinnen bezahlen, sondern die Finanzierung durch wissenschaftliche Institutionen oder gemeinnützige Organisationen erfolgt. Solche Modelle bieten eine mögliche Alternative zur hybriden Finanzierung.
Fazit: Zukunft des Hybrid Open Access
Hybrid Open Access hat sich als eine pragmatische, aber umstrittene Lösung etabliert. Während es kurzfristig den Open-Access-Gedanken fördert und Wissenschaftler*innen erlaubt, ihre Arbeiten in renommierten Zeitschriften frei zugänglich zu machen, bleibt es mit erheblichen Nachteilen verbunden. Hohe Kosten, mangelnde Transparenz und das Risiko der doppelten Abrechnung sind gravierende Herausforderungen.
Langfristig zeichnet sich ab, dass reine Open-Access-Modelle wie Gold oder Diamond Open Access an Bedeutung gewinnen werden. Initiativen wie Plan S und Transformationsverträge beschleunigen diesen Wandel und zielen darauf ab, Hybrid Open Access als rein Übergangslösung zu etablieren.
Daher lässt sich festhalten: Hybrid Open Access kann eine Brücke sein, doch für eine wirklich nachhaltige und gerechte Wissenschaftskommunikation bedarf es transparenterer und kosteneffizienterer Lösungen. Die Zukunft wird zeigen, ob der Übergang zu einem rein offenen Wissenschaftssystem gelingt.